Was ist eine Literaturrecherche?
Die Literaturrecherche umfasst alle Maßnahmen um relevante Literatur zu identifizieren. Sie reicht von einer zufälligen Bibliotheks- oder Internetrecherche bis zu einer systematischen Datenbankrecherche. Der Umfang und die Planung der Recherche ist abhängig von der Aufgabenstellung (Panfil, 2015).
Welche unterschiedlichen Herangehensweisen gibt es?
| Orientierend | Systematisch |
| Keine Empfehlung für Recherchewerkzeug | Anspruch: nachvollziehbar und wiederholbar |
| Am Anfang der Forschungsarbeit | Höhere Ansprüche an Entwicklung, Durchführung, Dokumentation |
| Identifizieren der wichtigen Veröffentlichungen | Recherchestrategie transparent und nachvollziehbar dokumentieren |
| Orientierung zum Thema | Vollständig |
| Unvollständig | |
| Notwendig für Fragestellung und ggf. Recherche zu präzisieren |
Tabelle 1 Unterschiedliche Herangehensweisen bei der Literaturrecherche (Panfil, 2015)
Wie läuft eine Literaturrecherche ab?

Abbildung 1 Ablauf Literaturrecherche (Bergheimer & Backhaus, 2018)
Im Folgenden werden die jeweils einzelnen Schritte der Literaturrecherche detailliert erklärt.
1. Recherchewerkzeuge auswählen
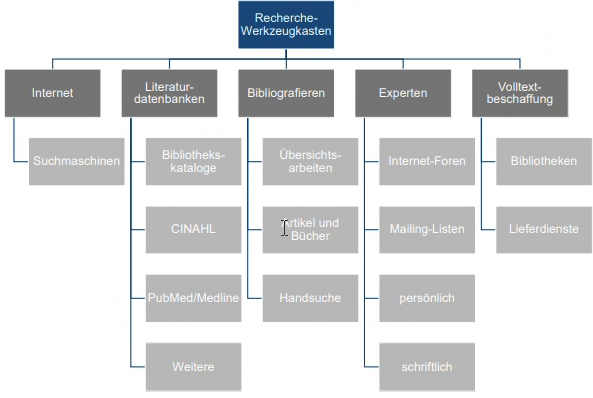
Internet
- Das Internet bietet eine unendliche Informationssammlung an, die zu einer diffusen Informationsflut führt.
- Es gilt aus der Menge an Informationen das “Richtige” zu finden.
- Durch die erweiterte Suche kann man die Suche einschränken:
- Bestimmte Wörter
- Erscheinungsjahr
- Sprache etc.
Literaturdatenbanken: PubMed & Co
- Bieten im Vergleich zum Internet eine systematische Alternative.
- Geben Informationen über Artikel und Bücher (Bibliografische Daten, Schlagwörter, Abstracts)
- Beispiele für Literaturdatenbanken für Fachartikel im Pflegekontext:
| PubMed/Medline | Medizin und Randgebiete |
| CINAHL | Pflege und weitere Heilberufe, kostenpflichtig über EBSCO |
| Cochrane Library | evidence-based medicine, kostenfreie Recherche, Volltexte kostenpflichtig |
| Und weitere z.B. Google Scholar | Wissenschaftliche Literatur (Artikel, Abschlussarbeiten, Bücher, Abstracts), kostenfrei |
Tabelle 2 Beispiele für Literaturdatenbanken für Fachartikel im Pflegekontext (Panfil, 2015)
2. Suchbegriffe festlegen
- Als Suchbegriffe sollten auch Synonyme und englische Übersetzung verwendet werden (Bergheimer & Backhaus, 2018).
- Zusätzlich können Verknüpfungen wie die Boole‘sche Operatoren als Verbindungselemente zwischen einzelnen Suchbegriffen fungieren.
| Boole'sche Operator | Wirkung | Trefferanzahl |
| AND | Artikel, in denen alle Suchbegriffe vorkommen. | Niedrig |
| OR | Artikel, die den ein oder anderen Suchbegriff enthalten. | Hoch |
| NOT | Artikel, in denen der eine Suchbegriff vorkommt und der andere ausgeschlossen wird. | Niedrig |
Tabelle 3 Boole’sche Operatoren (Panfil, 2015)
3. Suche eingrenzen
Die Suche kann durch verschiedene Filter eingeschränkt werden wie zum Beispiel:
- Bestimmten Zeitraum
- Verknüpfung mehrere Suchbegriffe
- Oder bei zu wenig Treffer Verknüpfungen weglassen oder den Zeitraum erweitern
Als Suchbegriffe sollten auch Synonyme und englische Übersetzung verwendet werden (Bergheimer & Backhaus, 2018)
4. Literatur auswählen
- Um die Relevanz der recherchierten Artikel für die jeweilige Forschungsfrage einordnen zu können, wird anhand des Titels eine erste Auswahl getroffen.
- Dann folgt die Sichtung des Abstracts, das eine Übersicht über Ziel, Methode und Ergebnisse gibt (Bergheimer & Backhaus, 2018).
- Graue Literatur: Veröffentlichungen im WWW (z.B. Google, Wikipedia); Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten
5. Literatur auswerten
- Originalartikel werden auf ihre Qualität und Relevanz hin überprüft (Aktualität und inhaltliche Relevanz für das Thema) (Pianos & Krüger, 2014).
- Wichtige Inhalte im Artikel werden markiert oder in einem eigenen Dokument herausgeschrieben (Bergheimer & Backhaus, 2018).
6. Literaturrecherche dokumentieren: beispielsweise mit PRISMA und Cooper
- Evidenzbasiertes Medium, um die systematische Literaturrecherche strukturiert zu dokumentieren und darzustellen.
- Preferred Reporting Items für Systematic reviews and Meta-Analyses
- Flussdiagramm zur Visualisierung und der Literaturrecherche und dem Ein- und Ausschließen von Literatur (Ziegler et al., 2011).
- Cooper-Taxonomie
- Einordnung der Literatur in zutreffende Kategorien und Unterkategorien
- Literatur wird dadurch klassifiziert (Hochrein et al., 2014).